Widersprüche im Denken und Wollen: Die vier Beispiele nach der Naturgesetzformel in Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" - Softcover
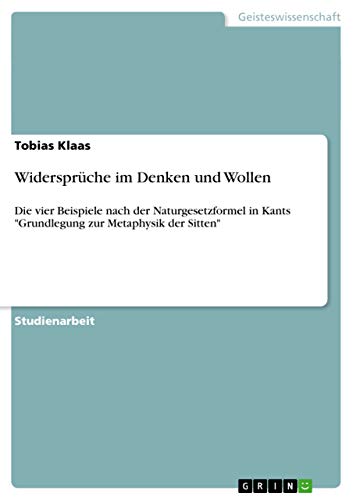
Zu dieser ISBN ist aktuell kein Angebot verfügbar.
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
- VerlagGRIN Verlag
- Erscheinungsdatum2012
- ISBN 10 3656328234
- ISBN 13 9783656328230
- EinbandTapa blanda
- Auflage2
- Anzahl der Seiten24
Neu kaufen
Mehr zu diesem Angebot erfahren
Versand:
EUR 32,99
Von Deutschland nach USA
Beste Suchergebnisse beim ZVAB
Widersprüche im Denken und Wollen : Die vier Beispiele nach der Naturgesetzformel in Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten"
Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, .), Note: 1,0, Universität Trier, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit seiner 'Grundlegung zur Metaphysik der Sitten' (GMS) eröffnete Immanuel Kant im Jahr 1785 seine Philosophie der Ethik. Dreh- und Angelpunkt dieser Schrift ist der berühmte 'kategorische Imperativ'. Dieser macht Kants Ethik, wenn dies auch oft falsch verstanden wurde, zu einer deontologischen Ethik. Im Rahmen der synthetischen Vorgehensweise im zweiten Kapitel kommt es zu einer ersten Abwandlung in der Formulierung des kategorischen Imperativs, der Naturgesetzformel, an welche vier Beispiele zur genaueren Einteilung derselben anknüpfen.Die Stimmigkeit dieser vier Beispiele ist bis heute zu recht sehr umstritten. Diese Arbeit stellt einen erneuten Versuch der Klärung dieser Beispiele dar. Für Kant ist klar, dass man Handlungsmaximen - kurz gesagt vom Willen ihm selbst auferlegte Prinzipien -, damit dessen entspringende Handlungen wahrhaft moralisch sein können, also 'aus Pflicht' geschehen, als allgemeines Gesetz 'wollen können'1 muss. Dies bildet die minimale Voraussetzung für eine Maxime, um als moralisch zu gelten, er nennt Maximen, die 'nur' diese erfüllen, unvollkommene Pflichten. Die vollkommenen Pflichten müssen zusätzlich nicht einmal gedacht werden können.2Je zwei der vier Beispiele beschreiben diese beiden Formen der Pflichten, jeweils eins für eine Pflicht gegen uns selbst und eins gegen andere. Da auch für diese Beispiele, die deontologische Ethik greifen und nicht etwa der Vorwurf des versteckten Utilitarismus für wahr befunden werden muss, steht und fällt die Naturgesetzformel mit den Begriffen 'Wollen-können' und 'Denken-können'. Das Hauptziel wird also deren Klärung sein. Dabei wird zuerst eine kurze Hinführung durch die GMS bis zu diesem Punkt gegeben. Im Anschluss, um das eigentliche Problem aufzuzeigen, soll der Begriff der 'deontologischen Ethik' und grundlegend Kants Begriffe des 'Willens' und der 'Maxime' geklärt werden. Um die Grundlage für die spätere Neudeutung der Beispiele zu geben, ist es unerlässlich, danach Kants Begriffe von 'Natur' und 'Freiheit' und deren Zusammenhang zu klären, bevor dann die eigentlichen Beispiele und die Unterschiede in den Begriffen 'denken' und 'wollen' behandelt werden. Artikel-Nr. 9783656328230
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

