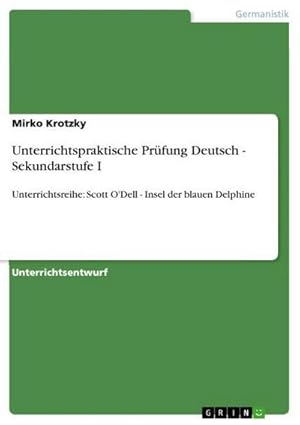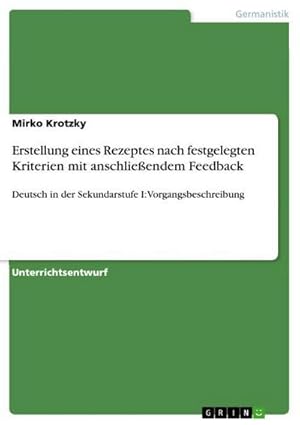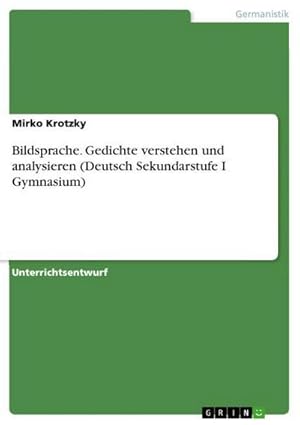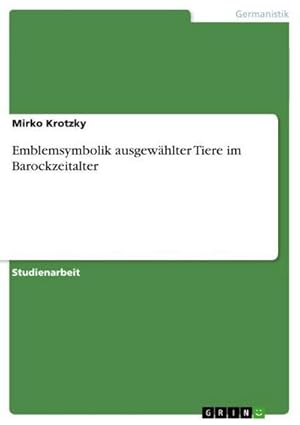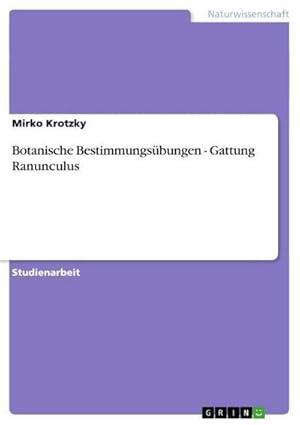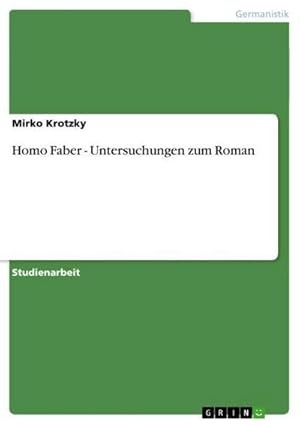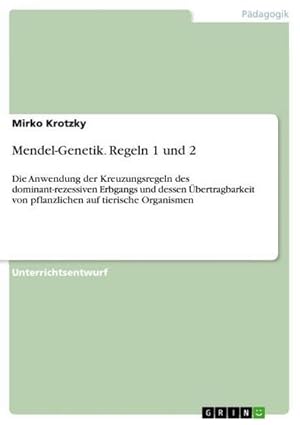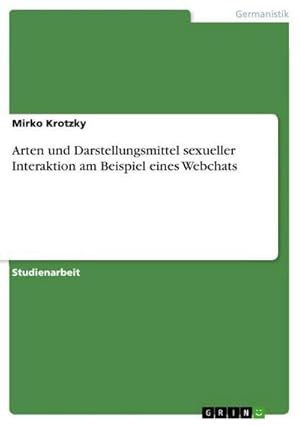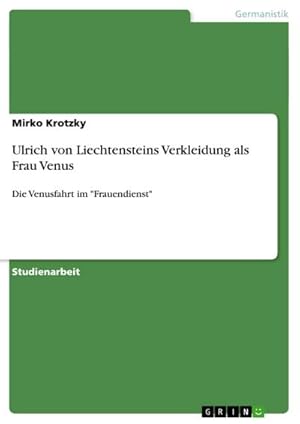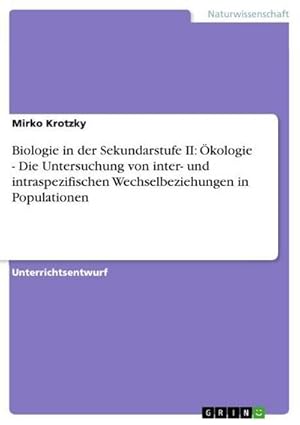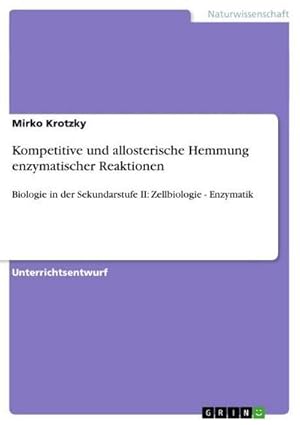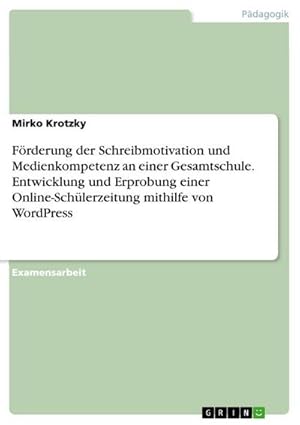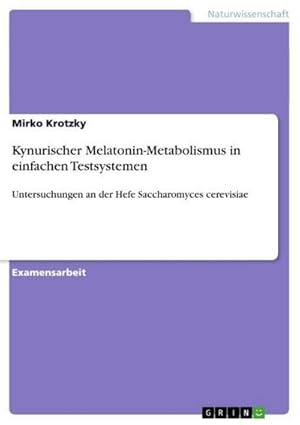mirko krotzky (17 Ergebnisse)
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (17)
- Magazine & Zeitschriften
- Comics
- Noten
- Kunst, Grafik & Poster
- Fotografien
- Karten
- Manuskripte & Papierantiquitäten
Zustand
Einband
- alle Einbände
- Hardcover
- Softcover (17)
Weitere Eigenschaften
- Erstausgabe
- Signiert
- Schutzumschlag
- Angebotsfoto (13)
Gratisversand
- Versand nach USA gratis
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Unterrichtspraktische Prüfung Deutsch - Sekundarstufe I : Unterrichtsreihe: Scott O'Dell - Insel der blauen Delphine
Verlag: GRIN Verlag, 2010
ISBN 10: 3640646169ISBN 13: 9783640646166
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Didaktik - Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,7, Studienseminar für Lehrämter an Schulen Arnsberg, Veranstaltung: Unterrichtspraktische Prüfung, Sprache: Deutsch, Abstract: Unterrichtsentwurf für die Unterrichtspraktische Prüfung in der Sekundarstufe I (Klasse 6) im Fach Deutsch für den Erwerb des 2. Staatsexamens für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen.Der Entwurf beinhaltet die folgenden Punkte: Thema der Unterrichtsreihe, Sachanalyse und Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe, Thema der Unterrichtsstunde, Ziele der Unterrichtsstunde, Kompetenzbezüge der Lernziele, Bedinungsanalyse, Hausaufgaben, geplanter Unterrichtsverlauf, Didaktisch-methodische Begründungen, geplante Tafelbilder und Materialien sowie Quellenangaben.Im der Unterrichtsstunde zugrundeliegenden zehnten Kapitel des von Scott O'Dell verfassten Jugendbuchs 'Insel der blauen Delphine' (1960) wird die Protagonistin des Romans mit der Entscheidung konfrontiert, weiterhin allein auf der Insel zu verbleiben, auf der sie nun nach der Abreise ihres Volkes und dem Tod ihres jüngeren Bruders allen drohenden Gefahren allein gegenübersteht, oder aber in einem baufälligen Kanu die gefährliche Seereise ins Ungewisse auf sich zu nehmen. Die vorliegende Unterrichtsstunde befasst sich nun mit der konkreten Behandlung dieses Zwiespalts, indem der Fokus der Lernenden auf die Nacht vor der Entscheidung sowie die Träume und damit den emotionalen Zustand der Protagonistin gelenkt wird. Dieser Zustand soll den Schülerinnen und Schülern (nachstehend 'SuS') mit Hilfe eines produktiven Verfahrens der Texterschließung verdeutlicht werden, indem sie sich in die Gefühlswelt des Indianermädchens hineinversetzen und diese beim Verfassen einer Traumbeschreibung nach in der Vorstunde erarbeiteten Kriterien berücksichtigen.
-
Erstellung eines Rezeptes nach festgelegten Kriterien mit anschließendem Feedback : Deutsch in der Sekundarstufe I: Vorgangsbeschreibung
Verlag: GRIN Verlag Okt 2011, 2011
ISBN 10: 3656022577ISBN 13: 9783656022572
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Didaktik - Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: keine, , Veranstaltung: Zwischenverbeamtung, Sprache: Deutsch, Abstract: Unterrichtsentwurf für die Zwischenverbeamtung in der Sekundarstufe I (Klasse 6) im Fach Deutsch für den Erwerb der Verbeamtung auf Lebenszeit für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (Studienrat). Der Entwurf beinhaltet die folgenden Punkte: Thema der Unterrichtsreihe, Sachanalyse und Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe, Thema der Unterrichtsstunde, Ziele der Unterrichtsstunde, Kompetenzbezüge der Lernziele, Bedinungsanalyse, Hausaufgaben, geplanter Unterrichtsverlauf, Didaktisch-methodische Begründungen, geplante Tafelbilder und Materialien sowie Quellenangaben. Konkret auf die vorliegende Unterrichtsreihe bezogen, impliziert der im Entwurf beschriebene Stundenverlauf die schwerpunktmäßige Schulung und Entwicklung der folgenden Kompetenzbe-reiche: Die Lernenden reflektieren die Kriterien der Beschreibung und lernen im Folgenden das genaue Beschreiben von Gegenständen kennen. Sie ordnen Begriffen Oberbegriffen zu und lernen eine einfache Art des Definierens. Der Unterschied zwischen situativer Beschreibung im Gespräch und notwendigen Erklärungen in beschreibenden Texten wird ersichtlich. Darauf aufbauend erwerben die Lernenden die Fähigkeit, eine Wegbeschreibung anhand einer Straßenkarte zu verfassen und im Kontrast dazu beschriebene Wege auf einer Straßenkarte zu finden. Kartenausschnitte werden begleitend durch die Lernenden zu einer Skizze vereinfacht. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Vorgänge in Teilschritte zerlegt werden müssen und stellen auf der Basis dieser Erkenntnis eine logische, kriteriengeleitete Ordnung der Teilschritte her, die unter Verwendung des Tempus Präsens zum vollständigen, bewertbaren Beschreibungstext ausgestaltet wird.
-
Bildsprache. Gedichte verstehen und analysieren (Deutsch Sekundarstufe I Gymnasium)
Verlag: GRIN Verlag, 2017
ISBN 10: 3668429693ISBN 13: 9783668429697
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Didaktik - Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,0, , Veranstaltung: Funktionsstellenbesetzungsverfahren, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Unterrichtsreihe 'Gedichte verstehen und analysieren' umfasst, ausgehend von individuellen persönlichen Erfahrungen der Lernenden, was eigentlich ein Gedicht zu einem Gedicht macht, welche künstlerische und ästhetische Gestaltung Gedichten in ihren unterschiedlichsten Formen zugrunde liegt, wie sich Gedichte dem 'Denken in Bildern' (Metaphern) bedienen, wie diverse rhetorische Stilmittel in Gedichten mit ihren jeweiligen Wirkungsabsichten zum Einsatz gelangen, wie in einer Rhetorikwerkstatt eigene Einfälle und Ideen dichterische Gestaltungsformen annehmen können, was einen Dichter ausmacht und wodurch sich seine Person definiert sowie den gelungenen Aufbau von Gedichtanalysen. Einen sachlogischen Abschluss erfährt die Reihe durch die Korrektur und abschließende kriteriengeleitete Bewertung fremder Gedichtanalysen, wodurch gleichzeitig eine transparente und verlässliche Vorbereitung der vierten Klassenarbeit in der 8. Jahrgangsstufe erreicht wird.Zum Stundenverlauf:Nach einem konfrontativen Einstieg durch Lehrervortrag des Gedichts 'Bitte an einen Delphin' von Hilde Domin lesen die SuS das Gedicht nochmals auf ihren Arbeitsblättern. Sie markieren dabei alle sprachlichen Bilder, die in diesem Gedicht sehr massiv auftreten und damit auffällig sind, und notieren zu zwei Bildern ihre pers. Assoziationen. Die Ergebnisse werden zunächst im Plenum besprochen, bevor sich eine weitergehende Partnerarbeitsphase zum Begriff 'Delfin' anschließt. Dazu entwerfen die SuS Assoziationssterne und notieren, welche persönlichen Gedanken sie mit einem Delfin verbinden, um dessen Bedeutung im Gedicht zu erschließen. Anschließend werden diese über einen Sachtext erweitert, der die Bedeutung des Delfins historisch nachzeichnet. Hierzu eignet sich die Think-Pair-Share-Methode: Die SuS markieren wichtige Informationen zum Thema, die ihr pers. Bild des Delfins bereichern, erst in Einzelarbeit. Anschließend vergleichen sie ihre Ergebnisse, ergänzen ihre Sterne und schreiben das Gedicht in einen pragmatischen Text um. Durch die Umschrift des lyr. Textes wird neben dem notwendigen Erkennen und Auflösen sprachlicher Bilder eine eigene Deutung des Ausgangstextes evoziert, die dem Plenum abschließend präsentiert, durch dieses ergänzt, hinterfragt und/oder korrigiert werden kann. Als Hausaufgabe erfolgt die Anwendung und der Transfer dieser neu erworbenen Techniken, indem die SuS die sprachlichen Bilder eines weiteren Gedichts in differenzierender Form umsetzen sollen.
-
Emblemsymbolik ausgewählter Tiere im Barockzeitalter
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638778088ISBN 13: 9783638778084
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Didaktik - Deutsch - Literaturgeschichte, Epochen, Note: 1.8, Georg-August-Universität Göttingen (Philologisches Seminar), Veranstaltung: Literaturwissenschaftsvorlesung Barock, Sprache: Deutsch, Abstract: Zunächst zur Bedeutung des Emblems: Der Begriff entstammt dem Griechischen (emblema) und kann mit 'Eingesetztes' übersetzt werden.Die bedeutendsten Künstler befassten sich mit Ersinnung und Ausarbeitung von Emblemen (B. Cellini, Leonardo da Vinci). Seit dem 'Emblematum liber' des Andreas Alciatus stand unter dem Bild ein Epigramm (Subscriptio), das Motto und Bild interpretierte. Der Autor stellte dem Leser mit der Deutung des Emblems eine Aufgabe, die seine Bildung herausforderte und gab ihm eine Regel zur Lebensführung. Sinn und Wortschatz der sehr verbreiteten Emblem-Bücher fanden starken Nachhall in der Dichtung, besonders im Barock.So existiert eine Fülle von Emblemen im Barockzeitalter, die verschiedene Aussagen und Thematiken beinhalten. Größtenteils dienen sie der sittlichen und moralischen Belehrung.Aufgrund meiner Fächerkombination Deutsch und Biologie möchte ich anhand dieser Arbeit Natur- und Tierbeschreibungen in der Literatur des Barock näher untersuchen. Schwerpunktmäßig werde ich dabei auf Embleme eingehen, die verschiedene Eigenschaften, welche den Tieren zugeschrieben wurden, verdeutlichen.Es werden dabei folgende Tiere behandelt: Zum einen die wirklich existenten Tiere, zu denen der Löwe und das Krokodil gehören und zum anderen die mystische Tierwelt, vertreten durch das Einhorn.
-
Botanische Bestimmungsübungen - Gattung Ranunculus
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638778096ISBN 13: 9783638778091
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Biologie - Botanik, Note: 1.6, Georg-August-Universität Göttingen (Biologische Fakultät), Veranstaltung: Botanisches Anfängerpraktikum, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Hausarbeit wurde angefertigt für den Erhalt des Leistungsscheins im Botanischen Anfängerpraktikum ",Botanische Bestimmungsübungen", , Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Morphologie der dicotylen Angiospermen-Gattung Ranunculus , zu deutsch Hahnenfußgewächse. Die Gattungsbezeichnung Ranunculus ist vom lat. rana = Frosch abgeleitet. Linné wählte diesen Namen, da viele Hahnenfußarten gehäuft in Gemeinschaft von Fröschen in Sümpfen vorkommen. Der deutsche Ausdruck hingegen spielt auf die Form der zerschlitzten Blätter an. Mit Ausnahme von sceleratus , was lat. = unheilvoll bedeutet, sind die anderen lateinischen Artnamen als deutsche Übersetzungen durchweg gebräuchlich.Die Familie der Hahnenfußgewächse ist sehr gattungs- sowie artenreich und enthält vor allem eine ganze Reihe wichtiger Giftpflanzen. Je nach Betrachtungsweise (Sammelart, Unterart) entfallen auf die Gattung Ranunculus zwischen 300 und 800 Arten, von denen etwa 70 für Mitteleuropa angegeben werden. Diese hohe Zahl ergibt sich durch die vor einiger Zeit vorgenommene Aufspaltung der vielen Sammelarten.Behandelt werden in dieser Arbeit vor allem die Pflanzen der Gattung, die in Gärten und Parks zu den bekanntesten und auch dekorativsten Pflanzen gehören, wie z.B. Ranunculus acris, der Scharfe Hahnenfuß. Die meisten Hahnenfußgewächse sind Kräuter mit leuchtend gefärbten Blüten, in aktuellem Fall gelb. Diese haben drei verschiedene Arten von Blütenhüllblättern: Kelch-, Kron- und Nektarblätter, die in manchen Floren auch unter der Bezeichnung Honigblätter geführt werden. In meiner Arbeit ziehe ich jedoch aus Gründen der Präzision die Bezeichnung Nektarblätter vor. Sie umgeben zahlreiche Staubblätter und viele Fruchtblätter, die zu einer mehrsamigen Balgfrucht oder einsamigen Nussfrüchten auswachsen. Ein weiteres typisches Kennzeichen der Familie sind die zerteilten, wechselständigen Laubblätter. Blatt, Blüte und Frucht weichen bei einigen Hahnenfußgewächsen von der Norm ab, worauf bei der Einzelbesprechung der Arten hingewiesen wird. Betrachtet man die Ranunculaceaen unter dem Gesichtspunkt der Wirkstoffe, fällt eine größere Anzahl von Gattungen auf, deren Arten das sogenannte Protoanemonin im Saft enthalten.Insbesondere werden die giftigen Arten Ranunculus ficária, Ranunculus ácris, Ranunculus bulbósus, Ranunculus flámmula und Ranunculus scelerátus sowie die Arten Ranunculus répens, Ranunculus aurícomus und Ranunculus lanuginósus behandelt, wobei auf die morphologischen Merkmale, die Wirkung der Giftstoffe sowie deren Verwendung in der Heilkunde und das Vorkommen der Arten genauer eingegangen wird.
Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB
Neu ab EUR 15,95
Gebraucht ab EUR 10,15
Mehr entdecken Softcover
-
Homo Faber - Untersuchungen zum Roman
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638777847ISBN 13: 9783638777841
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1.6, Georg-August-Universität Göttingen (Seminar für Deutsche Philologie), Veranstaltung: Proseminar: Einführung in die Erzähltheorie, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Hausarbeit für den Erhalt des Leistungsscheins im Proseminar Literaturwissenschaft II - Erzähltheorie , Abstract: Max Frischs Roman Homo faber erschien im Jahre 1957 und wurde ein noch größerer Erfolg als sein zuvor veröffentlichter Roman Stiller . Ebenso wie Stiller ist der Roman Homo faber eine in Tagebuchform konzipierte Ich -Erzählung. Frisch versucht, die Problematik einer Zeit aufzuzeigen, in der zwei Grundeinstellungen zum Leben miteinander in Konkurrenz stehen: einerseits die vorwiegend rational bestimmte Lebensweise, in der Wissenschaft, Technik und Mathematik fast ausschließlich die Denkweise beeinflussen; auf der anderen Seite Kunst, Mystik, Religion und Fantasie, die in der Anerkenntnis auch unerklärlicher Phänomene gipfeln. Allein die Bezeichnung Homo faber impliziert den Typus, welcher der Protagonist Walter Faber verkörpert. Faber , lateinisch: der Schmied, steht für den produzierenden, erfolgreich schaffenden und arbeitenden Menschen; der Ingenieur Faber steht somit für den erfolgreich tätigen, allein vom Verstand bestimmten und geleiteten Menschen der damaligen und auch noch heutigen Zeit. Bei vielen Arbeiten Frischs findet sich der Grundgedanke der jeweiligen Erzählung im Tagebuch 1946 1949 wieder, so dürfte es auch bei der Entstehung des Romans Homo faber der Fall gewesen sein. Ziel dieser Arbeit soll es sein, zum einen die Wandlung und Weiterentwicklung des Vollbluttechnikers Walter Faber vom mathematisch und rational denkenden Menschen, der alles durch Statistik und Rechnung bewiesen sehen will, zum naturbewussten und fiktionalen Gefühlsmenschen aufzuzeigen; zum anderen eben jenen Gegensatz von Natur und Technik, mitunter verkörpert durch den Protagonisten sowie andere vorkommende Charaktere, in seiner Entwicklung, Änderung und Darstellung aufzuzeigen und zu verdeutlichen.
-
Mendel-Genetik. Regeln 1 und 2 : Die Anwendung der Kreuzungsregeln des dominant-rezessiven Erbgangs und dessen Übertragbarkeit von pflanzlichen auf tierische Organismen
Verlag: GRIN Verlag, 2015
ISBN 10: 3656942161ISBN 13: 9783656942160
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Didaktik - Biologie, Note: 1,3, , Veranstaltung: Oberstudienratsbesetzungsverfahren, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Unterrichtsreihe 'Gene und Vererbung' umfasst, ausgehend von der grundlegenden Frage, was eigentlich unter Vererbung zu verstehen ist, die Bereiche der Meiose und Mitose, die Ausprägung von Merkmalen durch ihnen zugrunde liegende Gene, die Erarbeitung von klassischen Vererbungsregeln und deren Anwendbarkeit auf den Menschen mit Hilfe der Methode der Stammbaumanalyse sowie die Veränderlichkeit von Merkmalen, Fehler bei der Chromosomenverteilung und genetische Krankheiten bzw. Erbkrankheiten. Einen alltagsnahen Abschluss erfährt die Reihe über den Einblick in verschiedene Formen und Möglichkeiten der Gentechnik, wobei insbesondere deren Verständnis und ethische Beurteilung unterrichtlich relevant sind.Basierend auf der zentralen Frage, was genau eigentlich unter 'Vererbung' zu verstehen ist, wurden wiederholend der grundlegende Zellaufbau und die Rolle des Zellkerns als wichtigstes Zellorganell und Speicherort unserer Erbinformation behandelt. Das Verstehen der Vorgänge von Mitose und Meiose bildet die Grundvoraussetzung für das Verständnis der von MENDEL durchgeführten Kreuzungsversuche und der formulierten Vererbungsregeln.In der Vorstunde wurden mit den SuS MENDELs Vorgehensweisen und Techniken zur Erlangung reinerbiger Erbsenpflanzen erarbeitet. Im Anschluss wurde ein erster Kreuzungsversuch mit Hilfe einer animierten PowerPoint-Präsentation durchgeführt, wobei die Begrifflichkeiten der Parental- und Filialgeneration definiert wurden. Am Beispiel der bekannten Kreuzungsversuche von Erbsenpflanzen wurde die 1. MENDEL'sche Regel abgeleitet.Die SuS werden zunächst über einen Rückgriff auf den ersten Kreuzungsversuch mit einem weiterführenden Kreuzungsversuch konfrontiert, zu dem sie eine Problemfrage und darauf folgend sinnvolle Hypothesen entwickeln sollen. Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt durch die SuS selbst, indem sie die ihnen bekannten Kreuzungstechniken anwenden und zu einem entsprechenden Ergebnis kommen können. Mit dessen Hilfe werden die Hypothesen verifiziert bzw. falsifiziert.Die neu erworbenen Kenntnisse sollen nun auf eine neue Kreuzung angewendet werden, wobei neben der Anwendung der erlernten Kreuzungstechniken eine mögliche Übertragbarkeit der Vererbungsregeln von pflanzlichen auf tierische Organismen verdeutlicht wird.In der HA werden grundlegende Fachbegriffe angewendet und im Verständnis durch schriftliche Ausformulierung gefestigt. Letztlich wird die 2. MENDEL'sche Regel recherchiert und am Versuch angebunden.
-
Arten und Darstellungsmittel sexueller Interaktion am Beispiel eines Webchats
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638671143ISBN 13: 9783638671149
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, einseitig bedruckt, Note: 2,3, Georg-August-Universität Göttingen (Seminar für deutsche Philologie), Veranstaltung: Sprache und Sexualität, 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Bereits seit einiger Zeit ist in zahlreichen Magazinen wie der Coupé , Praline , Wochen-end oder selbst der Bild-Zeitung der Begriff Sexualität kein Tabuthema mehr, über welches aufgrund der Gefahr von Anstößigkeiten nicht geschrieben werden darf. Fernsehen, Buchautoren, ja selbst der Hörfunk stehen dem bis vor kurzer Zeit noch brisanten Thema, welches höchstens in privater, stiller Umgebung hinter den eigenen vier Wänden angesprochen wurde, mittlerweile offen und aufgeschlossen gegenüber. Vielfach wurde dies von Sprachwissenschaftlern erkannt und zum Anlass genommen, ihre Forschungen auch auf dieses Gebiet auszuweiten und zu konzentrieren. Im heutigen Informationszeitalter ist es daher unabdingbar, den Forscherdrang überdies auf neuartige Kommunikationsmöglichkeiten zu lenken.Eine wohl unbestreitbar revolutionäre Entwicklung stellt hierbei das Internet mit seinen zahlreichen Kommunikationsplattformen dar. Besonders hervorzuheben sind dabei die verschiedenartigen Chats, mit denen das Internet dem Nutzer aufwartet. Der Begriff chat ist dem Englischen entlehnt und steht für plaudern bzw. schwatzen . Früher geschah dies über den so genannten IRC (internet relay chat), welcher den Usern (Nutzern) jedoch ein umfangreiches Wissen über notwendige Befehlseingaben abverlangte und den Einsatz einer chatspezifischen Software (Telnet) forderte. Mit der Entwicklung neuartiger Webchats wurde dieser Nachteil beseitigt: Die User surfen über das Internet eine zentrale Chatseite an, bei der sie sich anmelden und unter fiktiven Namen einer Art Konferenzschaltung beitreten, deren einzelne Chaträume (Channel) meist durch ein zentrales Oberthema vorab charakterisiert sind. So finden sich bestimmte Themenchannel wie z.B. Jugendchannel im Sinne von Teen-Spirit oder Schueler und Channel für fremdsprachige Chatter wie Europa oder Bizim-Kanal wieder. Für diese Arbeit soll der Blick einzig und allein auf den erotischen Channeln liegen. Hierbei stellt der Webchat Chatcity eine überaus geeignete Kommunikationsplattform dar, da er alle möglichen Unterhaltungsthemen in einem Chat vereinigt und somit ein breites Userspektrum bietet, an dem Untersuchungen bequem vorgenommen werden können. Zentrales Untersuchungsthema sollen dabei die Möglichkeiten sein, die sich den Usern für eine erotische bzw. sexual-verbale Kommunikation bieten; aber auch Schwierigkeiten der Onlinekommunikation sollen gleichfalls erörtert und vorgestellt werden.
Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB
Neu ab EUR 17,95
Gebraucht ab EUR 11,18
Mehr entdecken Softcover
-
Ulrich von Liechtensteins Verkleidung als Frau Venus : Die Venusfahrt im "Frauendienst"
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638668363ISBN 13: 9783638668361
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,7, Georg-August-Universität Göttingen (Seminar für deutsche Philologie), Veranstaltung: Ulrich von Liechtenstein - Frauendienst, 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit wurde für den Erhalt des Leistungsscheins im Hauptseminar Mediävistik 'Ulrich von Liechtenstein - Frauendienst' verfasst. , Abstract: Die Person Ulrich von Liechtenstein (1200/1210 26.01.1275) ist sowohl der Autor des hier behandelten Werkes als auch der Protagonist seiner Erzählung. Zu Lebzeiten war er in der Steiermark beheimatet, gehörte einem wohlhabenden und einflussreichen Ministerialengeschlecht an und bekleidete einige bedeutende politische Ämter: In den Jahren 1244/1245 war er Truchsess unter Herzog Friedrich II., von 1267-1272 Marschall; im Jahr 1272 überdies Landrichter unter P emsyl Ottokar und somit Vertreter des Landesherrn bei Gerichtsverhandlungen und Landtaidingen. Aus dem Zeitraum von 1227-1274 sind 94 Urkunden, in denen sein Name genannt wird, erhalten; acht dieser Urkunden stellte Ulrich eigenhändig aus. Der Roman Frauendienst entstand in der Mitte des 13. Jahrhunderts und ist der erste Ich-Roman, der in deutscher Sprache verfasst wurde. Ulrich erlebt als Minnesänger und Ritter in seiner Erzählung vielerlei Abenteuer, die das Publikum zum Mitfühlen und Mitleiden, aber auch zur Teilnahme an gezielter Komik und Ironie einladen. Eine neben der Ich-Erzählung weitere Besonderheit des Romans stellt die für die damalige Zeit einzigartige Vermischung von lyrischer und epischer Form dar. So wird der Minnedienst erstmalig in der deutschen Literatur nicht mehr ausschließlich in der Tradition der Minnelieder als lyrisches Konstrukt in Liedform beschrieben, sondern eine andere, epische Form ergänzend und Lücken füllend integriert, um auf diese Weise das Vorgehen und die Erfahrungen des Helden im Dienst an seiner Herrin beschreiben zu können. Während seines Strebens für den hohen Minnedienst und die ritterlichen Tugenden veranstaltet Ulrich in seinem Frauendienst zwei außergewöhnliche Turnierfahrten: 1227 zieht er in Verkleidung als Frau Venus und um 1240 als legendärer Sagenkönig Artus durch die gesamte Steiermark (Österreich) bis nach Italien. Ziel dieser Arbeit soll es sein, vor allem die erste Reise, die so genannte Venusfahrt, mit Ulrichs Verkleidung als Frau Venus zu beleuchten und dabei insbesondere der Vorstellung der gewählten Kleidung und der offenbaren Gründe für Ulrichs getroffene Kleiderwahl sowie der damaligen Geschlechterrollen, des Begriffes Cross-Dressing und dessen potentiellen Nutzen für die Ausübung des Minnedienstes zu dienen. Alle Angaben zu Strophenzahlen im Frauendienst beziehen sich auf die Ausgabe: Ulrich von Liechtenstein: Frauendienst. 2., durchgesehene und verbesserte Auflage. Hrsg. von Franz Viktor Spechtler. Göppingen 2003.
-
Biologie in der Sekundarstufe II: Ökologie - Die Untersuchung von inter- und intraspezifischen Wechselbeziehungen in Populationen
Verlag: GRIN Verlag, 2010
ISBN 10: 3640739027ISBN 13: 9783640739028
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Biologie - Ökologie, Note: 1,7, Studienseminar für Lehrämter an Schulen Arnsberg, Veranstaltung: Unterrichtspraktische Prüfung, Sprache: Deutsch, Abstract: Unterrichtsentwurf für die Unterrichtspraktische Prüfung in der Sekundarstufe II (Grundkurs 12) im Fach Biologie für den Erwerb des 2. Staatsexamens für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen.Der Entwurf beinhaltet die folgenden Punkte: Thema der Unterrichtsreihe, Sachanalyse und Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe, Thema der Unterrichtsstunde, Ziele der Unterrichtsstunde, Kompetenzbezüge der Lernziele, Bedinungsanalyse, Hausaufgaben, geplanter Unterrichtsverlauf, Didaktisch-methodische Begründungen, geplante Tafelbilder und Materialien sowie Quellenangaben und Versicherung.Das zugrundeliegende Reihenthema 'Biotische Faktoren' umfasst die vielfältigen Beziehungen, welche Lebewesen mit anderen Lebewesen eingehen. Die Schülerinnen und Schüler (nachstehend 'SuS') haben sich bereits mit intra- und interspezifischen Beziehungen, mit Konkurrenz und verschiedenen symbiontischen Lebensweisen befasst.Die ökologische Bedeutung des Parasitismus wird schnell offensichtlich, wenn man berücksichtigt, 'dass mehr als 50% aller Lebewesen parasitär sind oder zumindest eine parasitische Phase in ihrem Leben haben.' In der Auseinandersetzung mit dem einzelligen Endoparasiten Plasmodium, welcher die gefährliche Infektionskrankheit 'Malaria' beim Menschen verursacht, sollen sich die SuS in der aktuellen Stunde dieser Bedeutung bewusst werden und erkennen, dass auch der Mensch von der Gefahr des Parasitenbefalls nicht ausgenommen ist.Malaria gehört weltweit zu den wichtigsten vektorbedingten Krankheiten. Im Jahre 2001 lebten in 101 Staaten und Territorien 2,4 Milliarden Menschen oder 40% der Weltbevölkerung in malaria-gefährdeten Gebieten, 400-500 Millionen werden jährlich neu infiziert und über eine Million Menschen, meistens Kinder unter fünf Jahre, sterben jedes Jahr an einer Malaria-Infektion, weshalb die exemplarische unterrichtliche Behandlung dieser Thematik aktueller denn je erscheint.Die SuS lernen zunächst den komplizierten Lebenszyklus des Malariaerregers Plasmodium kennen und erfassen, dass dieser für die sichere Fortpflanzung und das Auffinden eines Wirts sinnvoll ist. Durch das ausgewählte Beispiel wird deutlich, wie wichtig das Funktionieren interspezifischer Beziehungen für die Verbreitung und Erhaltung einer Art ist. Nach Erarbeitung dieser essentiellen Grundlagen sollen die SuS Möglichkeiten erfolgreicher Bekämpfungs- und Vorbeugungsmaßnahmen in Bezug auf die Malaria überlegen und diese erörtern.
Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB
Neu ab EUR 17,95
Gebraucht ab EUR 11,18
Mehr entdecken Softcover
-
Kompetitive und allosterische Hemmung enzymatischer Reaktionen : Biologie in der Sekundarstufe II: Zellbiologie - Enzymatik
Verlag: GRIN Verlag, 2013
ISBN 10: 3656524165ISBN 13: 9783656524168
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Didaktik - Biologie, Note: 1,3, , Veranstaltung: Verbeamtung auf Lebenszeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Unterrichtsreihe 'Die Zelle als Teil eines Organismus' umfasst die Einordnung der einzelnen Zelle in die unterschiedlichen biologischen Strukturebenen: Ausgehend von strukturellen Gruppen (Produzenten, Konsumenten, Destruenten) und grundlegenden Stoffkreisläufen haben die SuS einen allgemeinen Überblick bezüglich des Zusammenspiels von Assimilation und Dissimilation erworben, wobei die Fotosynthese exemplarisch mit Hilfe historischer Versuche sowie eines Schülerversuchs zur O2-Entstehung am Modellorganismus Elodea erarbeitet wurde. Die Zellatmung wurde in ihren Teilschritten (Glykolyse, Zitronensäurezyklus, Atmungskette) im Detail mit Hilfe von Strukturdiagrammen, Schemazeichnungen und Computeranimationen erarbeitet. Über die diesem Unterrichtsentwurf zugrundeliegende Unterrichtseinheit zur Katalyse durch Enzyme soll schlussendlich die Rückkehr zur Organismusebene eingeleitet und ermöglicht werden, indem unter Rückbezug auf katalytische Reaktionen eine Anbindung an den Stoffwechsel von der Zelle bis zum gesamten Organismus in Form einer abschließenden Gesamtübersicht verfolgt wird.Thema der vorliegenden Stunde soll es sein zu klären, wie eine Steuerung und Beeinflussung der Enzyme selbst in punkto Aktivität und Wirksamkeit erfolgen kann. Als zwei grundlegende Mechanismen zur Hemmung bzw. Regulation der Enzymaktivität gelten sowohl die kompetitive als auch die allosterische Hemmung, deren Bedeutsamkeit nicht nur bei rein körpereigenen Reaktionsprozessen, sondern auch im Zusammenspiel mit anorganischen Komponenten wie Schwermetallionen oder mit energiereichen Strahlungsarten deutlich wird.Die SuS werden zunächst mit einer Grafik eines unbeeinflussten enzymatischen Reaktionsverlaufs konfrontiert, anschließend wird diese Grafik durch zwei Reaktionsverläufe nach Zugabe eines kompetitiven und eines allosterischen Hemmstoffs ergänzt; beide Vorgänge sind den SuS bislang unbekannt. Aus genannter Grafik wird die Problemfrage der Stunde entwickelt, in der die SuS nach Gründen für die veränderten Reaktionsverläufe suchen. Nach der Sammlung von geeigneten Hypothesen werden die SuS in arbeitsteiligen Gruppen mit den beiden unterschiedlichen Hemmvorgängen vertraut gemacht. Im Anschluss dieser Erarbeitung essentieller Grundlagen werden von den SuS darauf basierende Funktionsmodelle zur Verdeutlichung beider Vorgänge entwickelt, welche vor der gesamten Lerngruppe präsentiert werden.
-
Förderung der Schreibmotivation und Medienkompetenz an einer Gesamtschule. Entwicklung und Erprobung einer Online-Schülerzeitung mithilfe von WordPress
Verlag: GRIN Verlag, 2011
ISBN 10: 3640909526ISBN 13: 9783640909520
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Examensarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Pädagogik - Medienpädagogik, Note: 2.0, Studienseminar für Lehrämter an Schulen Arnsberg, Veranstaltung: Hauptseminar, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Der Anhang dieser Arbeit enthält die Konzeptvorstellung für die neue Online-Schülerzeitung, zwei Werbeplakate für die neue Online-Schülerzeitung sowie einen Artikel zur Vorstellung der neuen Online-Schülerzeitung auf der Homepage der Gesamtschule. Der digitale Anhang der vorliegenden Staatsexamensarbeit fehlt, allerdings sind die enthaltenen Websites in der tagesaktuellen Form nach wie vor im Internet öffentlich zugänglich und können somit jederzeit eingesehen werden. , Abstract: Die vorliegende Hausarbeit beschreibt ein Konzept zur Entwicklung und Erprobung einer nicht nur völlig neuartigen, sondern auch innovativen Online-Schülerzeitung an einer Gesamtschule (nachstehend 'GS') als elektronisches Kommunikationsmedium mit dem konkreten Ziel, sowohl die Schreibmotivation der Schülerinnen und Schüler als auch deren Medienkompetenz im Internet zu schulen und zu fördern. Als ein geeignetes Medium zur Umsetzung dieses Vorhabens erscheint das frei erhältliche Internet-Weblog-System 'WordPress', welches sich bereits auf zahlreichen weiteren Internetseiten als Blog-System zur Veröffentlichung persönlicher Nutzerbeiträge seit nunmehr annähernd fünf Jahren bewährt hat und seine Schwerpunkte in den Bereichen Ästhetik, Webstandards und Benutzerfreundlichkeit setzt somit also ideale Voraussetzungen für eine Kommunikationsplattform als Basis einer dynamischen Online-Schülerzeitung bietet. WordPress selbst basiert auf PHP und MySQL und verlangt den Anwendern durch seine einfache Installation und Benutzerführung keine tiefer gehenden technischen Versiertheiten ab, was unter dem Gesichtspunkt einer angestrebten hohen Schülerakzeptanz und daraus resultierenden -aktivität als unabdingbar erscheint. Grundlage meiner Untersuchung sind sowohl das selbstständige, internetassoziierte Handeln als auch die Anzahl der entstandenen, online gestellten Schreibprodukte der an der AG beteiligten Schülerinnen und Schüler, woran aufgezeigt werden soll, inwieweit sich durch die gemeinsame Online-Zeitungsarbeit eine Entwicklung der internetspezifischen Medienkompetenz und der persönlichen Motivation zur selbstständigen Erstellung eigener Schreibprodukte feststellen lässt. An die konkrete Vorstellung der theoretischen Hintergründe schließen sich die gesammelten Erfahrungen, Erkenntnisse und Ergebnisse sowie Beschreibungen der praktischen Durchführung an, welche abschließend kritisch beurteilt und reflektiert werden sollen.
Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB
Neu ab EUR 27,95
Gebraucht ab EUR 19,36
Mehr entdecken Softcover
-
Kynurischer Melatonin-Metabolismus in einfachen Testsystemen : Untersuchungen an der Hefe Saccharomyces cerevisiae
Verlag: GRIN Verlag, 2008
ISBN 10: 3638914739ISBN 13: 9783638914734
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Biologie - Zoologie, Note: 1,0, Georg-August-Universität Göttingen (Johann-Friedrich-Blumenbach-Institut für Zoologie & Anthropologie), 72 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Melatonin war seit seiner Entdeckung als Neurohormon immer wieder Gegenstand zahlreicher Untersuchungen in Bezug auf seine Funktion, Struktur und Wirkung. Während eine ursprüngliche Rolle in Pigmentierungseffekten der Haut gesehen wurde, zeigte sich eine weitaus bedeutsamere Funktion als Mediator der Information Dunkelheit. Die klassische Vorstellung, dass Melatonin lediglich als Hormon des Pinealorgans sowohl bei tag- als auch nachtaktiven Vertebraten circadiane Rhythmen mit ausgeprägten nächtlichen Gipfeln aufweist und als Chronobiotikum wirkt, erfuhr durch die Entdeckung extrapinealer Bildungsorte, z.B. in diversen Zellen und Organen wie der Retina, der Haut, des Gastrointestinaltrakts, den enterochromaffinen Zellen sowie der HARDERschen Drüse und Leukocyten, eine beträchtliche Erweiterung. Schließlich rechtfertigt die Entdeckung von Melatonin in Bakterien, Protozoen, Pflanzen, Pilzen und Invertebraten von ubiquitärem Vorkommen zu sprechen. Außer dem Weg der Deacetylierung wurden auch Wege der Demethylierung und der 2-Hydroxylierung beschrieben, jedoch wiesen Hirata et al. (1974) einen völlig anderen, lange Zeit vernachlässigten Abbauweg des Melatonins in Form der oxidativen Pyrrolringöffnung nach. Aus dieser Pyrrolringspaltung des Indolamins resultieren als Metabolite die zwei substituierten Kynuramine AFMK und dessen deformyliertes Folgeprodukt AMK.Bereits in früheren Arbeiten konnte gezeigt werden, dass Saccharomyces cerevisiae Melatonin produziert, von außen aufnimmt und verstoffwechselt; ebenso, dass exogen gegebene Vorstufen in Melatonin umgewandelt werden können. Ziel dieser Arbeit soll es nunmehr sein zu überprüfen, ob auch die substituierten Kynuramine von.