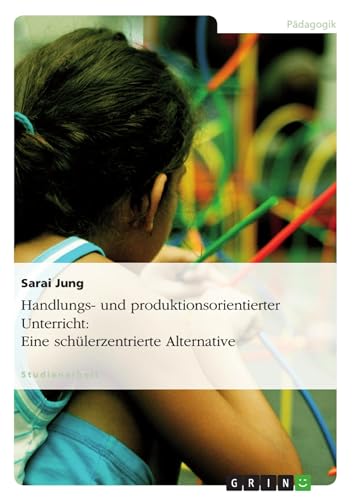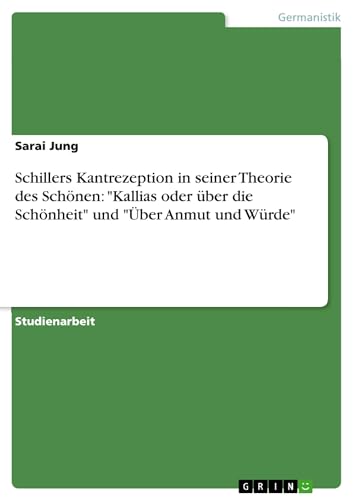sarai jung (10 Ergebnisse)
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (10)
- Magazine & Zeitschriften
- Comics
- Noten
- Kunst, Grafik & Poster
- Fotografien
- Karten
- Manuskripte & Papierantiquitäten
Zustand
Einband
- alle Einbände
- Hardcover
- Softcover (10)
Weitere Eigenschaften
- Erstausgabe
- Signiert
- Schutzumschlag
- Angebotsfoto (8)
Gratisversand
- Versand nach USA gratis
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht: Eine schülerzentrierte Alternative
Verlag: GRIN Verlag GmbH, 2007
ISBN 10: 3638641902ISBN 13: 9783638641906
Anbieter: medimops, Berlin, Deutschland
Buch
Zustand: good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.
-
Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht: Eine schülerzentrierte Alternative
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638641902ISBN 13: 9783638641906
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Didaktik - Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophisches Institut II), Veranstaltung: Epochenbilder im Deutschunterricht, Sprache: Deutsch, Abstract: Was ist eigentlich unter handlungs- und produktionsorientiertem Literaturunterricht zu verstehen Die Idee des Handelns impliziert aktives Tätigsein im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel. Dazu kommt die zweite Komponente, nämlich die Produktion. Das bezieht sich darauf, dass die Schüler nicht nur nachvollziehen und nachbilden, sondern gleichzeitig eigene Texte schaffen und selbst kreativ gestalten. In der Produktion von neuen, mehr oder weniger literarischen, auf jeden Fall aber eigenen Texten können die Schüler erfahren, wie und mit welcher Wirkung sie selbst literarische Formen verwenden können. Besonders wichtig ist, dass mit Hilfe von handlungs- und produktionsorientierten Verfahren die traditionelle Kluft zwischen Theorie und Praxis überwunden wird, so dass der Schwerpunkt nicht mehr nur auf der Kopfarbeit liegt, sondern alle Sinne mit eingebunden werden und auch 'Handarbeit' geleistet wird. Diese Art des 'learning by doing' entspricht auch den Erkenntnissen der Lernpsychologie. Außerdem verspricht man sich, auf diese Weise die Schule ein wenig näher an das wirkliche Leben heran zu führen. Denn natürliches Lesen ist immer auch ein aktives Mitgestalten der Sinnzusammenhänge eines Textes. Eine handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtsgestaltung zielt also auf eine ganzheitliche schüleraktive Form der Wissensvermittlung ab. Sie stellt den Anspruch, nicht bloßes Wissen zu vermitteln, sondern dieses Wissen 'Erfahrung' werden zu lassen. Die Schüler sollen Literatur und deren Besonderheit nicht nur kognitiv-analytisch lernen, sondern auch sinnlich erfahren und verstehen können. Man will zurückkehren zu dem ursprünglichen Zweck von Literatur und die Schüle wieder Lesegenuss lehren. Denn traditionelle Methoden, wie die der Textanalyse, liegen weit entfernt von einem natürlichen Lesen und von wirklichem Spaß an Literatur. Die vorliegende Arbeit gibt einen knappen Überblick über Grundlagen, Konzepte, Ziele und Vorteile, sowie Diskussionsansätze und methodische Aspekte des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts.
-
Intercultural relationships and national identities in E.M. Forster s novel 'A Passage to India'
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638644340ISBN 13: 9783638644341
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Seminar paper from the year 2003 in the subject English Language and Literature Studies - Literature, grade: 2+ (B), University of Würzburg (Philosophy Institut II - Anglistics), course: Writing the British Empire, language: English, abstract: E.M. Forster s novel 'A passage to India' was published in 1924. The work is largely based on the personal experiences Forster made during his two visits to India, which are the source of the striking authenticity of the text. Forster experienced the possibility of another view of life, that was opened up to him through his Indian friendships. On the other hand, he got to know the difficulties that spring up from so profoundly different approaches to life as the ones of the West and the East. Due to his own attitude of liberal-humanism and his belief in the freedom of action and the individuality of each human being as the basis for any political action, he was upset by the racial oppression, the cultural misunderstandings and the hypocrisies he found in Anglo-India. Forster s novel is clearly concerned with the doubtfulness of the concept of superiority. It puts forth the question to what extent a culture can claim to be a civilized nation and in virtue of what it can be justified to impose one s own way of life upon another culture. The author provides us with a vivid picture of Indian concepts and Indian sets of values without judging them or separating right from wrong. His suggestion seems to be to accept the co-existence of such alternatives. More complex is the problem of intercultural relationships. How can barriers be torn down and bridges be built To this question, Forster does not give a definite answer. He suggests a flourishing interchange between the races until the necessary cultural sensibility is achieved. At several points in the novel, the author hints at the general possibility of a peaceful relation between the two races: All the Indians who had been in England had had only positive experiences. But within a colonial context this seems impossible. Although reconciled, Aziz and Fielding have to accept that their friendship is not possible because they have no meeting place, at least 'not yet', not until India has her own nation and is free from the oppression of the colonial system.
-
Schillers Kantrezeption in seiner Theorie des Schönen: "Kallias oder über die Schönheit" und "Über Anmut und Würde"
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638641929ISBN 13: 9783638641920
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophisches Institut II), Veranstaltung: Hauptseminar: Schillers Ästhetik, Sprache: Deutsch, Abstract: Schiller zeigt sich seit seiner ersten Lektüre Kants von dessen Philosophie begeistert und beginnt, sich vor allem mit seiner Theorie des Schönen intensiv zu beschäftigen. Die Ergebnisse seiner Auseinandersetzung mit Kants Schönheitsbegriff finden ihren Ausdruck in dem Briefwechsel mit Körner, der unter dem Namen Kallias bekannt ist. In den Kallias-Fragmenten legt er die Grundlage seiner allgemeinen Schönheitstheorie, die er in der Abhandlung 'Über Anmut und Würde' auf den Menschen überträgt.Die vorliegende Arbeit versucht aufzuzeigen, inwiefern Kants Transzendentalphilosophie einerseits die Grundlage für Schillers Ästhetik bildet, den Dichter andererseits aber auch dazu veranlasst, Kants Ideen in einigen Punkten zu erweitern und sich an anderer Stelle deutlich von ihm zu distanzieren und den Versuch von alternativen Entwürfen zu wagen.Entgegen des Kantischen Subjektivismus versucht Schiller ein objektives Prinzip der Schönheit zu entwickeln, das auf bestimmten Merkmalen der schönen Gegenstände beruht. Er entwickelt eine Autonomieästhetik und verbindet somit die Idee der Freiheit mit der der Schönheit, was ihn zu der Definition führt, dass Schönheit 'Freiheit in der Erscheinung' sei. In eben dieser Verbindung erweitert er die Reflexionen Kants, der an dem Schönen hauptsächlich unter erkenntnistheoretischem Aspekt interessiert war. Schiller hingegen legt seinen Schwerpunkt weniger auf die Bedingungen menschlicher Erkenntnis, als vielmehr auf die Bedeutung solcher Erkenntnisse für den Menschen als ein Ganzes, für dessen Wollen und Handeln. Schillers anthropologisches Interesse ist es nun auch, was ihn dazu leitet eine Synthese von Moralphilosophie und Ästhetik anzustreben. Innerhalb seiner Abhandlung 'Über Anmut und Würde' entwirft er als Alternative zu Kants rigoroser Pflichtethik das Ideal der Schönen Seele, die die Pflicht aus Neigung erfüllt. Während Kant die Vollendung der Menschheit in der Herrschaft der Vernunft sieht, findet Schiller die Vollendung menschlichen Daseins in der Vorstellung des Spiels als harmonische Einheit von Sinnlichkeit und Vernunft. Beide jedoch suchen den Schlüssel zu einem gerechten und sittlichen menschlichen Zusammenleben in der Idee der Freiheit und der Selbsteinschränkung.
-
Protokoll einer Verstörung: Rainer Maria Rilkes "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"
Verlag: GRIN Verlag
ISBN 10: 3638777456ISBN 13: 9783638777452
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophisches Institut II), Veranstaltung: Proseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: In seinem Roman 'Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge' verarbeitet Rainer Maria Rilke den Schock, den er selbst erlitt, als er in die Metropole Paris kam. Eine fremde, bedrängende Stadt, auf dem Höhepunkt der industriellen Verstädterung. Ein Bild der unendlichen Gegensätze, in denen es einem sensiblen Ich, einem Künstler und Dichter wie dem Protagonisten Malte, nahezu unmöglich ist, sich gegen die Verunsicherungen durch die äußere Wirklichkeit zu behaupten. Die vorliegende Arbeit versucht die Unfähigkeit Maltes nachzuzeichnen und zu erklären, weshalb er sich in dieser Welt zunehmend verlieren muss. Er scheitert an der Entsetzlichkeit dessen, was 'Leben heißt', an der Einsamkeit, die er unter der anonymen Masse empfindet, an der Rücksichtslosigkeit der 'Anderen' und am Eindringen der unverständlichen Umwelt in das wehrlose 'Innere'. Doch es ist nicht nur die äußere Wirklichkeit, die Malte verstört, sondern auch seine eigene Innerlichkeit. Sein eigenes Erleben und seine Erinnerungen gewährleisten ihm keine verlässliche Wirklichkeit oder Sicherheit. In seine Gedanken und Gefühle schleichen sich ebenso bedrohliche Wahrnehmungen und Gefühle ein. Er ist sich selbst fremd. Seiner Umwelt und seiner Innerlichkeit ist Malte hilflos ausgeliefert. Die 'Aufzeichnungen' sind ein Versuch der Selbstfestigung, ein Versuch, 'unter dem Sichtbaren [.] Äquivalente [.] für das innen Gesehene' (MLB S. 89) zu finden und so die sich ihm offenbarende Realität zu bewältigen.
-
Zeit und Zeitgestaltung in erzählenden Texten am Beispiel von Erich Kästners - Sechsundvierzig Heiligabende
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638641910ISBN 13: 9783638641913
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophisches Institut II), Veranstaltung: Hauptseminar: Textlinguistik, Sprache: Deutsch, Abstract: Zeit - Was ist das eigentlich Nur sehr schwer lässt sich eine Antwort auf eine solch einfache Frage finden, obwohl es sich um ein ganz alltägliches Phänomen handelt, das aus unserem Leben nicht weg zu denken ist. Unser ganzer Alltag ist im Wesentlichen durch Zeit strukturiert und bestimmt. Zeit ist unbestritten objektiv messbar. Wenn man den einzelnen aber danach fragt, wie lange denn ein Augenblick dauert, oder eine Stunde, oder auch eine Ewigkeit, dann wird klar, dass die Zeitwahrnehmung alles andere als objektiv ist. Denn Zeit ist zweitens und vor allem subjektives Erleben. Drittens aber ist Zeit Geschichte, denn sie ist 'das was geschieht, und damit auch das, was wir über das Geschehene berichten, wie wir es sehen und verstehen'. Wenn wir sprechen, dann ordnen wir alles auf der Zeitachse in unser Koordinatensystem ein. Wir legen je nach unserem Empfinden und unseren Bedürfnissen fest, ob etwas zuvor, danach oder gleichzeitig geschehen ist; ob etwas vergangen, gegenwärtig oder zukünftig ist; wie lange etwas ungefähr oder genau gedauert hat.In einer Erzählung dürfen wir an der ganz persönlichen Zeiterfahrung eines Erzählers oder der Figuren seiner Geschichte teilhaben. Der Erzähler nimmt den Leser bei der Hand und führt ihn durch seine Geschichte, indem er die Zeitstrukturen bewusst gestaltet. Er greift stets strukturierend und ordnend in das Geschehen ein, reguliert das Erzähltempo und / oder unterbricht die lineare Abfolge der Geschehnisse durch Anachronien. Der Autor setzt bewusst eine Sprecher-Origo ein, von der aus die Ereignisse in die jeweilige Vor-Zeit (Vergangenheit), in die Gegenwart und Gleichzeitigkeit des Sprechaktes und in die Nach- Zeit (Zukunft) eingeordnet werden müssen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erzählung 'Sechsundvierzig Heiligabende' von Erich Kästner, die eine sehr komplexe und elaborierte Zeitgestaltung aufweist. Der Autor lässt die zeitlichen Ebenen ganz bewusst verschwimmen, so dass zwischen Gegenwart und Zukunft keine klaren Grenzen gezogen werden können, genauso wenig wie zwischen den unterschiedlichen Perspektiven der Hauptpersonen (Ich-Erzähler, Mutter). Es gelingt ihm, anhand der Zeitstruktur die Aussageintention seiner Erzählung zu unterstreichen.
-
Thomas Wentworth s speech 'In his Own Defense' - A historical approach to his rhetoric
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638721051ISBN 13: 9783638721059
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Anglistik - Linguistik, Note: 2+, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophisches Institut II - Anglistik), Veranstaltung: Historische Pragmatik, Sprache: Deutsch, Abstract: Das 17. Jahrhundert ist das Jahrhundert der großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Umstrukturierungen. England begibt sich auf den Weg von einer absolutistisch organisierten Monarchie zu einer demokratisch organisierten konstitutionellen Monarchie. Damit einher geht die Entstehung einer politischen Öffentlichkeit.Vor diesem geistesgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Hintergrund werden das Schreiben, das Drucken und das Lesen zu einem politischen Akt. Die Macht der Sprache und die Fähigkeit diese rhetorisch einzusetzen, um zu überzeugen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen, rückt damit ins Blickfeld. Das streng autoritäre Regime, das seine Legimitation in der gottgewollten Ordnung findet, versucht sich in einem verzweifelten Kampf gegen ein materialistisches, pragmatisch orientiertes zu Volk behaupten, das sich aus unterschiedlichen konkurrierenden Interessengemeinschaften zusammensetzt. Thomas Wentworth ist zeit seines Lebens eine sehr kontroverse Persönlichkeit, die Zeugnis ablegt von der Gespaltenheit der politischen Umbruchszeit: Prinzipiell Befürworter des demokratischen Prinzips, aber dennoch Verfechter der Monarchie spürt er die Kluft zwischen den kompromisslosen Forderungen des Parlaments und den Interessen des Königs bald als unüberbrückbar, so dass er sich gezwungen sieht, sich auf eine der beiden Seiten zu schlagen. Er entscheidet sich für die des Königs. Dennoch wird er aufgrund der Zuspitzung der politischen Lage am 25. November des Hochverrats angeklagt. Die zu analysierende Rede 'In His Own Defence' ist seine Verteidigungsrede, in der er die Fadenscheinigkeit des Vorwurfs des Hochverrats bloßstellt und zurückweist. Sie gewinnt ihm die Unterstützung der Richter und führt dazu, dass das Verfahren am 10. April vorerst eingestellt werden muss. Die vorliegende Arbeit untersucht Wentworths Rhetorik vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund. Er setzt alle Register der klassischen Rhetorik ein, spielt vor allem mit den traditionellen Redegattungen und Rollenverteilungen. Den 'plain style' der judizialen Redegattung durchbricht er immer wieder mit mitreißenden Passagen, in denen er an die Moral und die Emotionen der Anwesenden appelliert. Seine geschickt gewählten Argumente sind stets so aufgebaut, dass er die Zuhörerschaft zuerst logisch zu überzeugen versucht, dann jedoch immer auch ihre affektive Seite anspricht.
-
Schillers Kantrezeption in seiner Theorie des Schönen: "Kallias oder über die Schönheit" und "Über Anmut und Würde"
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638641929ISBN 13: 9783638641920
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Buch
Zustand: Wie neu. Zustand: Wie neu | Seiten: 32.
-
Höflichkeit in direktiven Sprechakten - Ein deutsch-spanischer Vergleich
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638644359ISBN 13: 9783638644358
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophisches Institut II - Germanistik), Veranstaltung: Höflichkeit und Soziale Stile des Sprechens, Sprache: Deutsch, Abstract: Direktiva sind Sprechakte, die vor allem im Hinblick auf die Höflichkeitsforschung immer wieder Gegenstand von Untersuchungen waren. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass gerade diese Kategorie ein fruchtbares Feld dafür bietet. Das verwundert nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass sie einen auffordernden Charakter haben und den Zweck verfolgen, den Adressaten dazu zu bringen, eine Handlung zu tun oder zu unterlassen. Auf diese Weise drückt ein Sprecher den Wunsch aus, dass eine zukünftige Handlung verrichtet wird und versucht, den Hörer sprachlich zu verpflichten, diese Handlung zu erfüllen. Searle zählt dazu vor allem Sprechhandlungen des Bittens, des Anweisens, des Befehlens, des Einladens, des Erlaubens, des Vorschlagens, usw. Die Durchführung einer impositiven Sprechhandlung ist immer mit einem Eindringen in die persönliche Sphäre des Anderen verbunden, was Brown & Levinson als Bedrohung des 'negative face' des Gegenüber darstellen. Die Sprecher setzen also zahlreiche sprachliche Mechanismen ein, die den Eingriff in die persönliche Sphäre des Anderen abschwächen sollen. Der Counterpart zu dem Konzept des 'negative face' ist das 'positive face', denn der Mensch als 'ens soziale' hat nicht nur individuelle und auf sich selbst bezogene Bedürfnisse, sondern definiert sich immer auch in Bezug auf die Gemeinschaft, in der er lebt. Auch dieses Recht auf Anerkennung wird in sprachlicher Hinsicht häufig bedacht, dem Gegenüber wird Wertschätzung signalisiert, um auf diese Weise das Gewicht des 'face threatening acts' zu mindern. Mit Hilfe einer empirischen Untersuchung, die anhand einer schriftlichen Umfrage durchgeführt wurde, sollten nun auf der einen Seite die potentiellen linguistischen Realisierungsweisen von Höflichkeit im Deutschen und im Spanischen Sprachraum erfasst und dann mit Hilfe von ausgesuchten Grammatiken und Aufsätzen aufgelistet und klassifiziert werden. Auf der anderen Seite wollten wir die pragmatische, das heißt die tatsächliche Verwendung des linguistischen Inventars quantitativ analysieren und vergleichen, um sprachspezifische Tendenzen aufzuspüren. Dazu wurden die Antworten der Testpersonen eingehend analysiert.
-
Höflichkeit kontrastiv: Verbalisierungsformen von direktiven Sprechhandlungen in Deutschland und Spanien
Verlag: GRIN Verlag, 2007
ISBN 10: 3638721426ISBN 13: 9783638721424
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Magisterarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Sprachwissenschaft / Sprachforschung (fachübergreifend), Note: 1,0, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophische Fakultät II), 81 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Wenn auch in unterschiedlicher Weise, so findet sich Höflichkeit doch in allen Gesellschaftsformen. Sie verfolgt das übergeordnete Ziel einer Gesellschaft, das soziale Miteinader einzelner Individuen auf der Basis von gemeinsamen Wertstrukturen zu sichern und so reibungslos wie möglich zu gestalten. In allen Kulturen haben sich dabei über Jahrhunderte hinweg Prioritäten hinsichtlich wegweisender Werte herauskristallisiert, die in ihrer Gesamtheit für den Inhalt spezifischer sozialer Normen verantwortlich sind. Sie haben zur Herausbildung sprachlicher Routinen und Konventionen, sowie zu kulturell bedingten Erwartungshaltungen und Interpretationsschemata geführt. Die vorliegende Arbeit versucht, einen ersten Ansatz für eine kontrastive Betrachtung des Deutschen und des Spanischen zu liefern. Die Grundlage für die Untersuchung bilden vor allem die klassischen Höflichkeitsmodelle von Lakoff (1973), Leech (1983), Brown & Levinson (1987) und Blum-Kulka et al. (1989) und die neueren Arbeiten im Rahmen der interkulturellen Forschung von Held (1994), Trosborg (1995) und Wierzbicka (1991). Diese theoretischen Grundlagen werden im ersten Teil ausführlich dargelegt. Zentrum der Arbeit bildet jedoch die Auswertung einer Untersuchung der tatsächlichen Sprachverwendung anhand einer Fragebogenerhebung, die an zwei Universitäten (Würzburg, Cádiz) durchgeführt wurde. Sie versucht einen eingehenden, aber sicherlich nicht erschöpfenden Einblick in sprachspezifische Realisierungsweisen der Bitte anhand von deutschen und spanischen Sprachdaten zu geben. Dabei wird zum einen das linguistische Repertoire gesammelt, zum anderen wird untersucht, ob sich klare kulturspezifische Differenzen und Präferenzen im Hinblick auf deren Verwendung zeigen, die Hinweise darauf geben könnten, dass sprachliche Strategien und Realisierungsweisen in den beiden untersuchten Sprechergruppen nicht das gleiche höfliche Potential besitzen und grundlegend anderen Interpretationsschemata unterliegen.